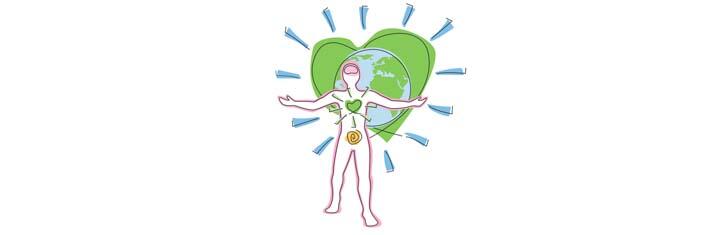Und plötzlich ging das Licht aus
Burnout als Neubeginn – Eine persönliche Erfahrung
 © bildwerk_hd – Fotolia.com
© bildwerk_hd – Fotolia.com
Leistung, Anerkennung, Erfolg – das sind die Götter, die in unserer Gesellschaft angebetet werden.Doch nicht selten bleibt der Mensch dabei auf der Strecke. Entsprechend viele leiden an Depression oder Burnout-Syndrom.Der raum&zeit-Autor Jens Brehl hat den Mut, sich zu öffnen und...
Weiter lesen
Aktuelles zum Thema
Ähnliche Artikel
Mediathek
zur MediathekVon Jens Brehl, Fulda – raum&zeit Ausgabe 169/2011
- Zwischen Selbstzweifel und Selbstbetrug
- Ein schleichender Prozess
- Moralische Konflikte
- Der Paukenschlag
- Das Eingeständnis
- Der erste Schritt
- Es geht bergauf
- Im Abseits
- Wie viele noch
- Der Autor
- Quellen
Leistung, Anerkennung, Erfolg – das sind die Götter, die in unserer Gesellschaft angebetet werden.
Doch nicht selten bleibt der Mensch dabei auf der Strecke. Entsprechend viele leiden an Depression oder Burnout-Syndrom.
Der raum&zeit-Autor Jens Brehl hat den Mut, sich zu öffnen und gibt uns einen ganz persönlichen Einblick in seine Geschichte.
Er erzählt uns von seinem Weg in die Hölle und wieder zurück.
Zwischen Selbstzweifel und Selbstbetrug
"Keine Sorge, ich bekomme das hin. Läuft.“ Ich lege den Hörer auf und bin erstaunt, wie flüssig mir die Lüge von den Lippen gegangen ist. Ich hoffe auf ein Wunder in letzter Sekunde, denn ich habe absolut keine Ahnung, wie ich den Auftrag bewältigen soll. Jedoch ist mir bisher immer eine Lösung eingefallen, schließlich bin ich nicht nur ein absolut zuverlässiger Journalist, sondern auch ein kreativer und unfehlbarer Presseberater – so mein Selbstbild. Warum es mir in letzter Zeit kaum noch gelingt diesem zu entsprechen, verschließt sich mir noch. Ich werde es aber bald erfahren.
Ein schleichender Prozess
Im Frühjahr 2008 lerne ich eine Kollegin kennen, die freiberuflich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. Schnell kommen wir ins Gespräch und bald auch ins Geschäft. Mein Medienbüro ist zum damaligen Zeitpunkt wenige Monate alt. Ich halte mich als freier Journalist und mit der Pressearbeit für kleine Unternehmen über Wasser. Zuvor hatte ich dabei mitgewirkt, ein Onlinenachrichtenportal aufzubauen, Geld habe ich dafür keines gesehen. Zurück in meiner Heimatstadt, gründete ich mein Medienbüro; der finanzielle Druck war seitdem immens.
Meine Kollegin hat einen dicken Fisch an der Angel. Sie fragt mich, ob wir den Kunden nicht gemeinsam betreuen möchten; meine Aufgaben wären die Textarbeiten, die Pflege des Presseverteilers und die Medienresonanzanalyse. Begeistert nehme ich das Angebot an, mein Einkommen steigt dadurch sprunghaft. Finanzielle Sorgen treten in den Hintergrund. Mein Arbeitspensum schießt weiter in die Höhe, tagelang verlasse ich mein Heimbüro und meine Wohnung nicht mehr. Die sozialen Kontakte finden per E-mail und Telefon statt und beschränken sich auf die berufliche Ebene. Für Freunde, Familie und ein Privatleben im Allgemeinen habe ich schon lange keine Zeit mehr. So kommt es, dass ich mich allwöchentlich auf den Freitag freue: An diesem Tag gehe ich Lebensmittel einkaufen und sehe daher viele Menschen.
Neben dem Großkunden kann ich weitere Projekte gewinnen. Im Herbst 2008 scheine ich endlich meinen Durchbruch geschafft zu haben. Nie zuvor habe ich mehr Geld verdient. Ich steigere mich in einen wahren Schaffensrausch hinein und finde es schick, überarbeitet und ausgelaugt zu sein. Es verdeutlicht in meinen Augen, dass ich ein sehr gefragter und viel beschäftigter Mensch bin – ich empfinde mich als ein erfolgreiches und wertvolles Mitglied der Gesellschaft.
Moralische Konflikte
Zunächst habe ich viel Freude mit meiner Arbeit für den Großkunden. Man ist mit meinen Leistungen zufrieden und hin und wieder erreicht mich ein Lob. Mir ist bewusst, dass das Unternehmen die Welt nicht zu einem besseren Ort macht und kaum gemeinnützige Ziele verfolgt. Bis dato war ich der Meinung, ich könnte den Spagat zwischen der Pressearbeit für diesen speziellen Kunden und meiner Tätigkeit als wahrhaftiger Journalist bewältigen. Das eine ist eben der Brotjob, das andere die Leidenschaft. Spätestens als ich Personalabbau in einer Pressemitteilung positiv darstelle und einige Medien den Text unverändert übernehmen, kann ich den moralischen Konflikt nicht mehr leugnen.
Der Paukenschlag
Wenige Wochen später ist meine Aufgabe simpel: Ein Pressetext für das Großunternehmen, reiner Standard, moralisch dieses Mal vertretbar. Ich kenne alle relevanten Fakten und habe den ungefähren Wortlaut bereits im Kopf. Doch die Idee möchte nicht geboren werden: Meine Finger weigern sich das zu tippen, was ich denke. Jede Formulierung ist für sich betrachtet eine Katastrophe, von einem roten Faden möchte ich gar nicht erst reden. Mit einem Schlag glaube ich zu wissen, dass ich meinen Verstand verloren habe. „So fühlt es sich also an, wenn man verrückt wird“, schießt es mir durch den Kopf. Plötzlich ergeben die vorangegangenen Anzeichen einen Sinn für mich: Ich schaffe es kaum, pünktlich meine Arbeiten abzugeben und reihe einen (Anfänger-) Fehler an den anderen. Klingelt das Telefon, bekomme ich augenblicklich Panikattacken, bei denen mein Herz aus meiner Brust zu springen scheint. Was habe ich wieder falsch gemacht, welche neue Katastrophe erwartet mich? Lege ich nach dem Telefongespräch auf, kann ich mich nur noch selten an dessen Inhalt erinnern. Angst meine E-mails abzurufen stellt sich ein. Wann ich das letzte Mal gut geschlafen habe, weiß ich nicht mehr: Albträume plagen mich. Es fällt mir immer schwerer aufzustehen und in den Tag zu starten. Ich kann Ewigkeiten von meinem Bett aus die Zimmerdecke anstarren. Meine Umwelt nehme ich nur noch grau wahr. Wenn ich einen lustigen Film schaue, denke ich, „jetzt musst du lachen“, und verziehe dennoch keine Miene. Nichts scheint mich mehr zu berühren. Der Sinn des Lebens war noch nie so weit entfernt wie jetzt. Im Januar 2009 erreiche ich meinen gesundheitlichen Tiefpunkt. Eines Morgens wache ich auf und stelle mir eine Frage: Springe ich lieber aus dem Fenster oder versuche ich meine Arbeit zu erledigen? Bei beiden Optionen verschließt sich mir ein tieferer Sinn. Das gibt mir zu denken.
Das Eingeständnis
Nachdem ich sämtlichen Mut gesammelt habe, bitte ich meine Kollegin um ein Gespräch. Meine Hände zittern so stark, dass ich Mühe habe, die Tasse zu halten und keinen Tee zu verschütten. Ich beginne zu stottern und mache es daher kurz: „Ich bin am Ende“, lautet meine lapidare Feststellung. Mit knapper Not kann ich meine Tränen zurückhalten. Zu meinem Erstaunen ernte ich Verständnis. Ich habe keineswegs den Verstand verloren, ich sei einfach ausgebrannt. Meiner Kollegin sei es selber einmal so ergangen. Ich bin also kein Einzelfall? Zu diesem Zeitpunkt lebe ich bereits so isoliert, dass es außerhalb meiner Vorstellung liegt, anderen Menschen könnte es ähnlich wie mir ergehen. Ich verspreche meiner Kollegin, einen Arzt aufzusuchen. Seit Jahren hatte ich keine Praxis mehr von innen gesehen, lediglich die Zahnarztbesuche waren regel- mäßig.
Aus den Gelben Seiten wähle ich einen Allgemeinmediziner aus. Ich schäme mich bei meinem Besuch in Grund und Boden. Doch der Arzt nimmt sich zu meiner Überraschung Zeit für mich und diagnostiziert ein depressives Erschöpfungssyndrom, umgangssprachlich Burnout. Es kommt mir so vor, als habe er mir damit den Versager-Stempel aufgedrückt. Ich fühle mich absolut wertlos, da ich nicht mehr arbeiten kann. Einen Platz in der Gesellschaft habe ich damit in meinen Augen nicht verdient. Mit der Überweisung zum Neurologen tue ich mir sehr schwer. In meinem Kopf geistern die Bilder von (angeblich) verrückten Menschen, die weggesperrt werden – nachts ans Bett gefesselt und bis zur Unterlippe mit Psychodrogen abgefüllt.
Ich begreife meine Lage jedoch als so hoffnungslos, dass ich einen Termin wahrnehme. Ich erläutere die Umstände und gestehe die Tatsache ein, dass ich in den letzten zwölf Monaten bereits drei Zusammenbrüche hatte. Die Intensität hat sich jedes Mal gesteigert. Mir ist es jedoch gelungen, sie zu verdrängen und meine Arbeit weiterhin zur vollen Zufriedenheit der Auftraggeber zu erledigen. Das könne ich jetzt auch tun, meint der Therapeut. Den ersten Herzinfarkt würde er bei dieser Vorgehensweise im nächsten halben Jahr erwarten, meint er trocken. Mir scheint, als würden wir aneinander vorbeireden: Ich muss so schnell wie möglich wieder leistungsfähig werden. Medikamente lehne ich ab, denn ich möchte keine Sucht heraufbeschwören. Die Versuchung, mich abends mit Alkohol zu betäuben, war bereits verlockend genug; es hat mich sehr viel Energie gekostet, standhaft zu bleiben. „Fit für die Arbeit? Guter Mann, ich mache ihnen sofort einen Aufnahmetermin in einer Klinik.“ Sagt es und greift zum Hörer. Vor Entsetzen bringe ich keinen Ton heraus. Versteht der Typ denn nicht, dass ich dafür keine Zeit habe? Schließlich kam wenige Tage zuvor ein neuer Auftrag herein. Zudem bin ich mehr als skeptisch. Auf meinen Wunsch hin zählt der Arzt mögliche Behandlungsmethoden auf: Tiefenpsychologische Gespräche, Körperwahrnehmungsschulung, Malen, Töpfern, Besuche in der Natur und dergleichen. Irgendwie gelingt es mir, die Augen nicht zu verdrehen. Er erahnt meine Bedenken und erläutert mir, dass ich in keine geschlossene Anstalt käme, sondern in eine Psychosomatische Klinik. Das sei ein himmelweiter Unterschied. Ich sei nicht verrückt und es würde nichts gegen meinen Wunsch geschehen.
Der Aufnahmetermin ist in sechs Wochen. Nun heißt es für mich warten. Ich schaffe es, den neuen Auftrag zu erledigen. Ich schreibe eine passable Pressemitteilung, baue einen Verteiler für den Kunden auf und verschicke den Text zum gewünschten Datum. Den Großkunden haben meine Kollegin und ich informiert, dass ich aus gesundheitlichen Gründen als Berater ausscheiden werde; bis dahin muss noch einiges für ihn erledigt werden. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft dafür nehme. Der private Alltag überfordert mich zusehends. Alle Tätigkeiten, die ich bisher im Vorbeigehen erledigt habe, strengen mich sehr an. Ich bin ein nervliches Wrack und es bedrückt mich, wenn ich mir dafür auch noch selber die Beweise liefere. Wenn ich drei Dinge aus dem Supermarkt benötige, muss ich sie mir vorher notieren. Merken kann ich sie mir nicht. Das Treppenhaus müsste ich mal wieder putzen, was ein Aufwand von 20 Minuten bedeutet. Ich mache daraus ein Zwei-Tage-Projekt: Am ersten Tag stelle ich den Putzeimer parat und suche das passende Reinigungsmittel, um dann am Tag darauf tatsächlich zu wischen. Ich bewege mich wie durch Watte. Es kostet eine enorme Willensanstrengung überhaupt etwas zu tun.
Der erste Schritt
Eineinhalb Monate darauf stehe ich vor dem Eingang und lese die großen Letter darüber: Psychosomatische Klinik. So tief bin ich also gesunken. Mutlos ziehe ich meinen Koffer hinter mir her und melde mich an. Später am Tag treffe ich die Patienten meiner Station und bin das erste Mal seit langem wieder Teil einer sozialen Struktur. Das macht mir Angst. Generell bin ich skeptisch, verstehe einen Teil der Krankenhausvorschriften nicht. Es fällt mir schwer, mir die vielen Regeln überhaupt zu merken.
Die Balkontür meines Einzelzimmers ist abgeschlossen; es befindet sich im sechsten Stock. Der Kalender weist Frühjahr aus, davon unbeeindruckt üben die Temperaturen derweil für den Hochsommer. In meinem Zimmer ist es mittags daher stickig und ich kann lediglich ein kleines Fenster über der Balkontür öffnen. Zwei Mal in der Woche gibt es eine Stationsrunde. Wir, die Patienten, sitzen im Kreis zusammen mit unseren beiden Therapeuten und der Stationsschwester. Hier werden zentral die einzelnen Sorgen und Fragen besprochen. Wer eine offene Balkontür möchte, muss es sagen. Ich melde mich unsicher, meine Stimme ist kurz vor der Kapitulation, Tränen wollen in die Augen schießen. Durch reine Willensanstrengung kann ich das verhindern. „Kann meine Balkontüre geöffnet werden?“ bringe ich unsicher hervor. Meine Therapeutin nimmt die Frage zur Kenntnis und bittet mich zu einem persönlichen Gespräch später am Tag.
Ein paar Stunden nach der Stationsrunde sitze ich meiner Therapeutin gegenüber. „Können Sie mit einer offenen Balkontür umgehen?“ Ich verstehe die Frage nicht, denn wie man eine Tür öffnet, habe ich als Kind gelernt. „Sind Sie in der Lage, bei Problemen auf sich aufmerksam zu machen und sich Hilfe zu holen?“ Der Groschen fällt und ich bin geschockt. Die Ärztin möchte wissen, ob ich mich vom Balkon stürzen möchte. Ich erinnere mich, von meinem Gedankengang, bei mir zu Hause aus dem Fenster zu springen, erzählt zu haben. Es erstaunt mich, dass meine Aussage überhaupt wahrgenommen wurde. Langsam dämmert mir der Ernst der Lage, in der wir uns alle befinden. Es gelingt mir, die Therapeutin zu überzeugen. Am Nachmittag schließt die Stationsschwester lächelnd die Tür auf und ich betrete den Balkon. Meine Brust spannt sich unter den tiefen Atemzügen und ich habe einen Schritt in die richtige Richtung getan.
Es geht bergauf
Im Krankenhausalltag finde ich mich langsam aber sicher zurecht. Es entstehen Bänder zwischen meinen Mitpatienten und mir. Unsere Gespräche tun mir sehr gut. Kaum einer trägt eine Maske, die meisten zeigen sich so, wie sie sind und mit all ihren Schwächen. Gegenseitig haben wir oft mehr voneinander erfahren als nahe stehende Familienangehörige. Teilweise entsteht unter uns Patienten das Gefühl, sich länger als nur ein paar Wochen zu kennen. Das schweißt zusammen.
Ich erkenne, dass sich Depressionen mit oder ohne Burnout durch alle Schichten und Altersklassen unserer Gesellschaft ziehen: Vom Studenten, über den Arbeitslosen, der Hausfrau, den Angestellten, dem Unternehmer bis zum Rentner. So unterschiedlich die Menschen sind, haben doch einige eines gemeinsam: Sie glauben zu einem gewissen Grad funktionieren zu müssen, um geliebt werden zu können und wertvoll zu sein. Sie unterdrücken die eigenen Bedürfnisse und verausgaben sich im Gegenzug dafür physisch und seelisch.
Das Krankenhaus nehme ich als Taucherglocke wahr: Die Außenwelt ist noch vorhanden, aber wir sind geschützt. Ich blühe mehr und mehr auf, besonders in der weichen Therapieschiene, für die ich eingeteilt wurde. Ich male mit Fingerfarben meine Gefühle, verbringe viele ruhige Momente in der Natur und öffne mich in den tiefenpsychologischen Gesprächsrunden. Einmal in der Woche wird mir schwimmen verordnet. Ich plansche das erste Mal seit Jahren im Wasser. Zunächst versuche ich Leistung zu bringen, indem ich in möglichst kurzer Zeit möglicht viele Bahnen zurücklege. Doch schon bald gehe ich zum entspannten Schwimmen über und genieße meine Zeit im nassen Element. Ich beginne, mich von meinem inneren Einpeitscher, von dem Müssen zu lösen.
Plötzlich kann ich an einem warmen Sonntagnachmittag auf der Parkbank sitzen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Der Drang, in jedem Moment produktiv sein zu müssen, ist in den Hintergrund gerückt. Ich bin entschleunigt. Die Therapien gefallen mir, denn letzten Endes wird die Selbstverantwortung gefordert, der Selbstkontakt gefördert und die Selbstfindung ermöglicht. Außenstehenden ist es schwer zu vermitteln, was wir tun. Im Grunde erinnern mich unsere Übungen oft an den Kindergarten. Zunächst werte ich daher automatisch alles ab, später erkenne ich, wie wichtig es ist, sein inneres Kind auszuleben. In der Körperwahrnehmungsschulung legt man uns kleine Sandsäckchen auf den Rücken. Wie fühlen sie sich an? Schwer, leicht, kalt, warm, angenehm, unangenehm? Was passiert, wenn das Säckchen einige Zentimeter verschoben wird? Ändert sich die Wahrnehmung? Ich beginne, meinen Körper zu spüren und nicht nur, wenn etwas wehtut; ich fühle bewusst in mich hinein. Ein anderes Mal „zeichnet“ ein Mitpatient mit einem kleinen Ball Buchstaben auf meinen Rücken und ich muss sie erraten. Macht Spaß, doch es gibt einen Patienten, der keinen einzigen Buchstaben nennen kann; er spürt sich und seinen Rücken nicht.
Es gibt auch unangenehme Situationen, immer dann, wenn eine unbequeme Wahrheit auf den Tisch kommt. Wenn es darum geht, sein Selbstbild zu hinterfragen. Ich erkenne, dass ich mich nur anhand meiner Leistung definiert habe: Je mehr ich arbeite, umso wertvoller bin ich. Ein alter Glaubenssatz will mir weismachen, dass ich alles im Leben erkämpfen muss – ein fataler Trugschluss, der mich immer wieder in die Erschöpfung treibt. Das Arbeitstier Jens kenne ich, der Mensch Jens ist mir erschreckend fremd. Ich stehe in meinem Zimmer vor dem Spiegel. „Wer bist du?“ frage ich mein Konterfei. „Finde es heraus“, lautet die Antwort.
Im Mai 2009 erfolgt meine Entlassung. Ich gelte immer noch als „arbeitsunfähig“; sieben Wochen habe ich in der Klinik verbracht. Zu Hause soll ich mich um einen Gesprächstherapieplatz kümmern. Einfacher gesagt als getan. Einige Psychotherapeuten nehmen keine neuen Patienten an, wenn doch, ist der früheste Termin Mai 2010. Durch eine Fügung bekomme ich doch noch einen Platz und sitze nun einmal in der Woche einer mir fremden Person gegenüber, die ich an meiner intimen Gedankenwelt teilhaben lassen soll. Es stimmt mich ein wenig traurig, dass ein solches Vorgehen nötig ist. Im Grunde sollten diese Gespräche in der Familie und im engsten Freundeskreis geführt werden. Anscheinend ist dies in unserer Gesellschaft jedoch für viele zunehmend schwierig. Ich möchte nicht meckern, die Gespräche waren teilweise hilfreich und andererseits ist es vielleicht leichter, sich zunächst einem Außenstehenden zu öffnen. Zumindest gab es eine Kontrollfunktion, dass ich nicht wieder in alte Muster zurückfalle. Nach etwa 20 Gesprächen ist auch diese Therapie beendet und ich stehe wieder mitten im Leben.
Beruflich habe ich meinen Weg gefunden und bin weiterhin als freier Journalist tätig. Ich widme mich Themen, die mir am Herzen liegen und mich mit Freude erfüllen. Unstimmige Aufträge lehne ich ab und ernte dafür teilweise Unverständnis. Das ist mir jedoch egal. Ein Fernstudium, welches ich mittlerweile erfolgreich abgeschlossen habe, war mein Wiedereinstieg in die Arbeitswelt. Als ich die ersten Hausarbeiten schrieb, zitterten meine Finger gewaltig. Ich habe meine Versagensangst nicht betäubt oder verdrängt, sondern mich mit ihr auseinandergesetzt; habe die Botschaft der Angst beleuchtet.
Im Abseits
Depressionen und Burnout sind immer noch Tabuthemen. Ganz so aufgeschlossen wie sie glaubt, ist unsere Gesellschaft nicht. Burnout ist der umgangssprachliche Begriff einer seelischen Erkrankung, die mit Überlastung, Erschöpfung und meist mit depressiven Verstimmungen einhergeht. Sie ist äußerst ernst zu nehmen, denn oft ist sie ein (Mit-) Auslöser für diverse weitere Symptome, bei denen keine körperlichen Ursachen gefunden werden können. Die Grenze zu lebensgefährdenden Depressionen ist fließend. Betroffene benötigen dringend Hilfe, doch aus Scham schweigen viele.
Emotionen dürfen in den eigenen vier Wänden stattfinden, öffentlich scheint es keinen oder nur begrenzt Raum für sie zu geben. Wenn doch, dann nur für bestimmte. Dafür sind jede Menge Medikamente erhältlich, um Emotionen zu kontrollieren oder ganz zu unterdrücken. Mag man einer Studie 1 der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) aus dem Frühjahr 2009 Glauben schenken, so „dopen“ zwei Millionen Arbeitnehmer, 200 000 von ihnen sogar regelmäßig. Körperlich gesunde Beschäftigte schlucken Betablocker gegen Herzrasen, Demenz- und ADHS-Medikamente zur Konzentrationsstärkung und Anti-Depressiva gegen seelische Belastungen mit dem Ziel, in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz funktionieren zu können.
Depressionen werden in unserer Gesellschaft als Schwäche angesehen und daher gerne totgeschwiegen. Vielerorts schämen sich Familien für ihre depressiven Mitglieder oder wissen nicht, wie sie mit ihnen umgehen sollen, was sich als äußerst kontraproduktiv erweisen kann. Wer das Schweigen bricht und sich zu seinen Depressionen bekennt, ist mutig. Dennoch begeht die Person häufig gesellschaftlichen und beruflichen Selbstmord, wird zum Außenseiter. Der ehemalige Profi-Fußballer Andreas Biermann hat zwei Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. 2 Nach seinem ersten Versuch 2004 wurde „lediglich“ ein Burnout diagnostiziert, eine Depression blieb unerkannt und war Biermann zu diesem Zeitpunkt selber nicht bewusst. Kurz vor dem Freitod Robert Enkes leitet Biermann Abgase in das Innere seines Wagens. Er und sein Verein FC St. Pauli verschweigen den Selbstmordversuch. Erst als Enkes Frau die Krankheit ihres Mannes nach dessen Freitod öffentlich macht, beginnt Biermann zu begreifen. Er erkennt seine Depression, vertraut sich seinem damaligen Trainer an und begibt sich in stationäre Behandlung. Damit besiegelte er das Ende seiner Karriere, wie Biermann im Vorfeld befürchtete. Sein Verein und auch kein anderer Verein möchte ihn unter Vertrag nehmen. Er könne die Verantwortung nicht verkraften. Biermann rät deshalb Profi-Fußballern, sich zwar in Behandlung zu begeben, aber die Erkrankung nicht öffentlich zu machen. Traurig, denn das Verleugnen ist für den Heilprozess kontraproduktiv. Nach Enkes Freitod sollte sich so viel ändern, hat es aber nicht. Aus diesem Grund trägt Biermanns im Frühjahr 2011 erscheinendes Buch den Titel „Rote Karte Depression“.
Auch ich hatte bisher Angst zu reden und damit künftige Auftraggeber zu verschrecken. Ich befürchtete, dass ich als nicht belastbar und als unzuverlässig gelten würde. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Als mich ein Bekannter nach meiner Krankheitsgeschichte fragte, konnte ich sie in einem Satz darlegen: Einmal durch die Hölle und zurück. Der Weg hat sich gelohnt und ich empfinde ihn als wertvoll und nicht mehr als Stigma.
Ich konnte die Krankheit ohne Psychopharmaka hinter mir lassen. Meine Erfahrungen möchte ich nicht mehr missen. Ich kenne meine Grenzen nun sehr genau, habe den Blick für das Wesentliche bekommen, kann mit Stress viel effektiver umgehen und dadurch meine Kreativität erhalten. Dazu gehört, dass ich mich selber sehr bewusst wahrnehme. Ich weiß, was mir schadet und was mir gut tut. Somit entscheide ich mich täglich für eine authentische Arbeitsweise. Ich bin in einem stärkeren Selbstkontakt als jemals zuvor. Darüber hinaus habe ich gelernt, frühzeitig zu kommunizieren, Grenzen zu ziehen und auf (körperliche) Warnzeichen zu achten. Meinen Beruf nehme ich wieder als Möglichkeit wahr, mich auszudrücken und zu entfalten. Kurz: Ich bin wieder mit Freude dabei und bleibe mir selber treu. Dadurch ist meine Leistung langfristig gesichert. Anders als Jemand, der kein Gespür für seine Bedürfnisse entwickeln konnte, sich total verausgabt und irgendwann wie eine Supernova verglüht. Erfolg lässt sich nur bedingt durch materiellen Besitz messen, die Lebensqualität ist entscheidend. Freude, Glück, und Sinn stehen in keinem Verkaufsregal.
Wichtig ist, dass es Menschen gibt, die ehemalig Betroffenen Vertrauen schenken und sie wieder einbinden. In eine Ecke gestellt zu werden, verstärkt die Mauer des Schweigens. Damit diese Risse bekommt und vielleicht eines Tages komplett einstürzt, habe ich mich dazu entschlossen, offen mit meinen Erfahrungen und meiner Erkrankung umzugehen. Bewusst habe ich darauf verzichtet, diesen Artikel unter Pseudonym zu veröffentlichen.
Wie viele noch
Wenn ich heute durch die Straßen meiner Stadt laufe, betrachte ich die Gesichter der anderen Passanten mitunter sehr genau. Viele von ihnen tragen eine Maske mit einem ausdrucklosen Gesicht zur Schau. Sie möchten möglichst wenig von sich preisgeben oder gar durch ein abgeklärtes Auftreten Unsicherheiten verbergen. Ein scheinbar erfolgreicher Mann im Anzug kommt mir entgegen. Aktentasche in der linken Hand, in der rechten klebt das Mobiltelefon, welches er an sein Ohr presst. Sein Mienenspiel ist geschäftig; er hat keinen Blick für sein Umfeld. Seine Maske ist meiner früheren sehr ähnlich. Ob er wohl glücklich ist? Fragt er sich in stillen Momenten nach dem Sinn seines Lebens oder hetzt er von Termin zu Termin ohne zu merken, dass das Leben an ihm vorbeirauscht? Was würde ich tun, wenn ich die Traurigkeit und innere Leere bei ihm spüre? Besäße ich den Mut ihn anzusprechen?
Der Autor
Jens Brehl wurde 1980 in Fulda geboren. Nach Abschluss einer kaufmännischen Lehre gründete er einen eigenen Vertrieb für Gesundheitsprodukte. Seine wahre Leidenschaft entfaltete er jedoch im Journalismus, dem er sich 2005 zuwandte. Seit 2007 führt er in Fulda sein Medienbüro, arbeitet als freier Journalist und begleitet in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Seine Themenschwerpunkte liegen bei Umwelt, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Medien, Gesundheit und
anzheitlicher Medizin. www.jens-brehl.de
Quellen
1 Deutsche Angestellten-Krankenkasse: „Doping am Arbeitsplatz: Rund zwei Millionen helfen nach“, Gesundheitsreport 2009, 12.02.2009
2 Interview mit Andreas Biermann: „Ich rate keinem Fußballer, sich zu outen“, Welt online, 09.11.2010, http://www.welt.de/sport/fussball/article10768249/Ich-rate-keinem-Fussballer-sichzu- outen.html
Im Online-Archiv finden Sie den Artikel zum Thema als PDF-Format
Im Online-Archiv finden Sie einen weiteren Artikel zum Thema
Im Online-Archiv finden Sie einen weiteren Artikel zum Thema
Artikel "Und plötzlich ging das Licht aus" online lesen
Klicken Sie auf folgenden Link um den Artikel online zu lesen:
Artikel online lesenMehr zum Thema Gesundheit
- AIDS
- Allergie
- Alte Heilmittel
- Augenheilkunde
- Aura
- Ayurveda
- Borreliose
- Burnout
- Clustermedizin
- Corona
- Demenz
- Diabetes
- Dialyse
- Energie-Medizin
- Epigenetik
- Ernährung
- Gesundheitspolitik
- Herz
- Homöopathie
- Immunsystem
- Impfen
- Körbler-Methode
- Krebs
- Long Covid-19
- Naturheilkunde
- Rheuma
- Schilddrüse
- Virus-Wahn
- Wasser
- Zahnmedizin