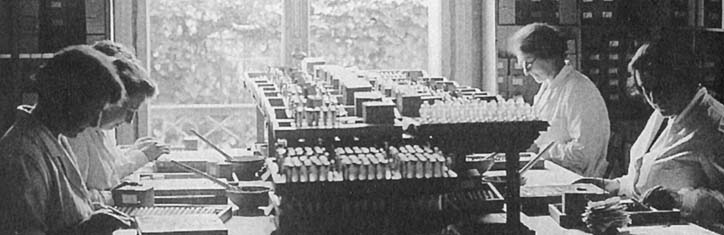Länger leben, besser schlafen, mehr Energie, das und mehr verspricht Biohacking. Doch was steckt wirklich hinter dem Begriff? Dieser Artikel erklärt, woher der Trend kommt, welche Methoden wissenschaftlich fundiert sind und wie sich Biohacking ganz ohne Hightech im Alltag nutzen lässt.
Wer heute im Netz nach dem Stichwort Biohacking sucht, bekommt eine schillernde Mischung aus Tipps, Tools und Methoden präsentiert: Das Morgenlicht wird auf Kommando simuliert, smarte Matratzen analysieren den Schlaf und der Blutzuckerspiegel wird im Minutentakt überwacht. Manche schwören auf Eisbäder, andere auf High-Fat-Kaffee, wieder andere nehmen Nahrungsergänzungsmittel in schwindelerregenden Dosierungen und andere nutzen eine Vielzahl von am Körper getragenen Wearables (Fitnesstracker) und technischen Helfern. Doch in Wahrheit ist Biohacking weit mehr und zugleich viel einfacher als viele glauben. Denn im Kern geht es um eine zentrale Frage: Wie können wir durch bewusstes Verhalten unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verbessern, unsere Gesundheit stärken und das eigene Wohlbefinden nachhaltig fördern? Diese Idee ist nicht neu, aber sie bekommt durch neue Technologien und Erkenntnisse aus der Forschung eine neue Relevanz.
Biohacking mit Bodenhaftung
Ursprünglich stammt der Begriff Biohacking aus der Tech-Szene und wurde in den 2000er-Jahren vor allem durch US-amerikanische Unternehmer und Selbstoptimierer geprägt. Inspiriert von der Softwareentwicklung begannen sie, den menschlichen Körper als System zu betrachten, das sich wie ein Programm analysieren, anpassen und optimieren lässt. Was damals wie ein nerdiges Randphänomen wirkte, hat sich heute zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Biohacker wollen verstehen, wie Ernährung, Bewegung, Schlaf, Atmung, Licht, Temperatur, Gedanken und sogar soziale Beziehungen unseren Körper beeinflussen und wie sich diese Faktoren gezielt steuern lassen.